 | Film - Info |  |
 | DER KRIEG DES CHARLIE WILSON("Charlie Wilson's War") (USA, 2007) Regie: Mike Nichols Film-Länge: 97 Min. |  DVD kaufen (Amazon) #Anzeige  BluRay kaufen (Amazon) #Anzeige |
 Kino-Start: 07.02.2008 |  DVD/Blu-ray-Start: 13.01.2011 |  Streaming-Start: 05.04.2009 (WOW (sky)) |  Free-TV-Start: 18.07.2010 (RTL) |
"Der Krieg des Charlie Wilson" - Handlung und Infos zum Film:
"Der Krieg des Charlie Wilson" handelt von der wahren Geschichte eines gleichnamigen Kongressabgeordneten (Tom Hanks) aus Texas, der in den 80er Jahren dafür sorgte, dass die russische Invasion in Afghanistan ein Ende nahm. Mit Hilfe seiner on/off-Liebhaberin und Freundin, der schwerreichen Joanne Herring (Julia Roberts), und dem bärbeißigen, zynischen CIA-Agenten Gust Avrakotos (Philip Seymour Hoffman) schafft es der ewige Junggeselle, Genießer und Politiker Wilson in den USA soviel Geld aufzutreiben, dass sich die Mujaheddin von den Russen befreien können.
Dabei fällt Wilson die desolate Lage Afghanistans zum ersten Mal 1979 auf. Und zwar ausgerechnet, als er mit mehreren nackten Stripperinnen auf einer Party in einem Whirlpool sitzt. Diese zwei Seiten des Charlie Wilson sind es, die den Held dieser Geschichte so ungewöhnlich machen: er feiert gerne, steht jede Woche auf ein anderes Mädel, trinkt zu viel und ist ein Meister der geschickten politischen Gefälligkeiten. Aber: er ist auch klug, mit einem analytischen Verstand gesegnet, diplomatisch und seinen Prinzipien treu. Auf diese Weise schafft er es, gemeinsam mit der tiefreligiösen überzeugten Anti-Kommunistin Herring und dem erklärten Russen-Hasser Avrakotos, Afghanistan befreien zu lassen. Keine leichte Aufgabe, denn während die meisten seiner Politiker-Kollegen nicht mal wissen (wollen) wo Afghanistan auf der Landkarte liegt, muss er sie überzeugen, dass das Land das letzte Bollwerk gegen die sich ausbreitende Sowjetunion ist. Nebenbei stockt er den Etat für geheime Operationen dort von 5 Millionen auf eine Milliarde Dollar jährlich auf. Um Waffen für die Mujaheddin zu besorgen, schafft Wilson außerdem das Unmögliche: er holt erklärte Feinde wie Pakistan, Saudi-Arabien, Ägypten und Israel mit ins Boot.
"Der Krieg des Charlie Wilson" ist schwer einzuordnen. Es handelt sich um einen politischen Film mit biographischen Zügen, eine Komödie, eine Gesellschaftsstudie – und zumindest zum Schluss auch um eine frustrierte Abrechnung mit der Art und Weise der amerikanischen Einmischung an den Krisen-Herden dieser Welt. Tom Hanks und Julia Roberts sind dabei gewohnt gut. Hanks gibt den augenzwinkernden Macho mit enorm viel Ausstrahlung und ist nie eindimensional. Hervorragend auch die Szene als die kühl, aber sympathisch rüberkommenden Roberts sich die Wimpern mit einer riesigen Sicherheitsnadel trennt, während sie über Politik philosophiert. Philip Seymour Hoffman beweist einmal mehr, dass er seine Schauspielkunst so viele Facetten hat wie das Auge einer Fliege. Ebenso souverän und erwähnenswert ist Om Puri als pakistanischer Präsident. Bei manchen Nebenrollen – wie der von Emily Blunt – fragt sich zwar, warum sie so prominent besetzt sind. Dem Film tut das aber nun wirklich keinen Abbruch. Bei allem hat man den Eindruck, dass Regisseur Mike Nichols seine Stars allenfalls anstupsen musste – so echt kommen der Wortwitz und die Charaktere rüber.
| Die Redaktions-Wertung: |  | 80 % |
Autor/Bearbeitung: Simone von der Forst
Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Update: 31.01.2019
Alle Preisangaben ohne Gewähr.
© 1996 - 2026 moviemaster.de
Technische Realisation: "PHP Movie Script" 10.2.1; © 2002 - 2026 by Frank Ehrlacher



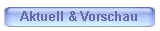
 DVD / Blu-ray
DVD / Blu-ray
 Alle OSCAR®-Gewinner
Alle OSCAR®-Gewinner